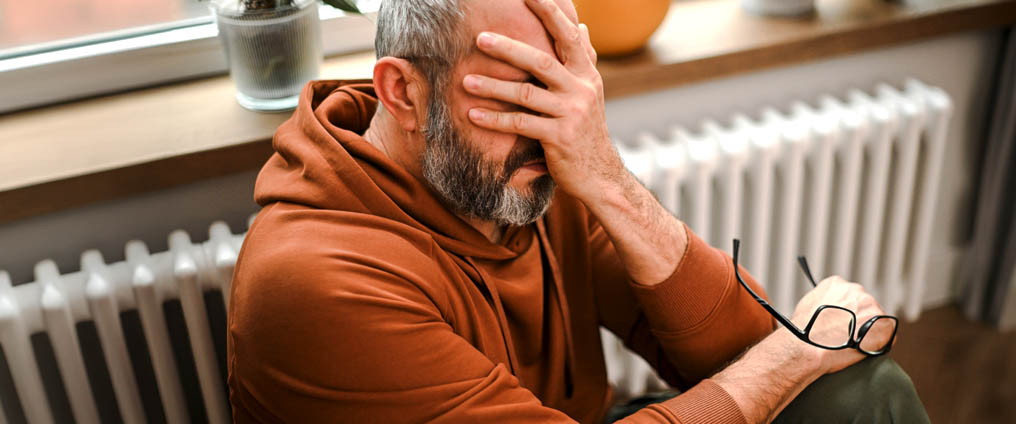Borderline: Symptome und Therapie

Schnelleinstieg in unsere Themen
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine Persönlichkeitsstörung, die oftmals im frühen Erwachsenenalter ausbricht. Menschen mit Borderline leiden unter starken Stimmungsschwankungen, ihre Gedanken, Wünsche und Einstellungen ändern sich innerhalb kürzester Zeit. Zusätzlich treten weitere und vielfältige Symptome auf, welche es schwer machen, eine Borderline-Störung zu erkennen. Auslöser dieser Persönlichkeitsstörung sind oft traumatische Ereignisse in der Kindheit. Die Behandlung besteht daher in einer auf den Patienten individuell angepassten Psychotherapie. Dabei können Patienten lernen, ihre Krankheit zu verstehen, ihr Verhalten zu kontrollieren und Warnsignale wahrzunehmen.
Was ist Borderline?
Borderline gehört zu den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen. Sie hat ein vielfältiges Gesicht und ist vor allem durch eine mangelnde Gefühls- und Impulskontrolle geprägt. Betroffene neigen zu unkontrollierten Handlungen ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Auslöser dieser Verhaltensweisen sind rasch auftretende Zustände einer inneren Anspannung. Außerdem erleben die Betroffenen ein chronisches Gefühl der inneren Leere.
Unter den psychisch Erkrankten leidet etwa jeder Fünfte zusätzlich zu seiner Erkrankung auch an einer Borderline-Störung. Dabei sind besonders Patienten mit einer affektiven Störung, posttraumatischen Belastungsstörung oder Essstörung betroffen.
Erste Symptome einer Borderline-Persönlichkeitsstörung treten überwiegend mit Beginn des frühen Erwachsenenalters auf. Die Intensität der Symptome schwächt sich nach dem 30. Lebensjahr meist ab. Obwohl das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist, finden sich in der psychiatrischen Versorgung deutlich mehr Frauen.
Was sind Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung?

Die ersten Symptome einer Borderline-Persönlichkeitsstörung treten meist mit Beginn des Erwachsenwerdens (Adoleszenz) auf. Die Symptome können bei den Betroffenen sehr unterschiedlich in ihrer Art und Ausprägung sein, wodurch die Diagnose dieser psychiatrischen Erkrankung erschwert wird.
Die Hauptmerkmale der Borderline-Störung sind die starke eingeschränkte Impulskontrolle und die damit einhergehenden Stimmungsschwankungen. Den Betroffenen fehlt die Fähigkeit, Erlebtes und die dadurch ausgelösten Gefühle angemessen zu kontrollieren und zu regulieren. Daraus resultieren extreme innere Anspannungszustände, die Betroffene als unerträglich empfinden. Um diese Spannungszustände kurzfristig abzubauen, kommt es dann zu impulsiven und häufig unkontrollierbaren Handlungen. Diese Handlungen können sich in einem erhöhten Risikoverhalten, Drogenkonsum, Essanfällen, Abbrüchen von sozialen Kontakten oder einer Therapie widerspiegeln.
Zusätzlich kann es zu einer Abspaltung nicht aushaltbarer Gefühle kommen (Dissoziation), um die innere Anspannung besser zu ertragen. Ein Gefühl könnte beispielsweise Angst sein.
Einige Betroffene neigen auch zu selbstverletzendem Verhalten und fügen sich beispielsweise Brandwunden zu, indem sie Zigaretten am eigenen Körper ausdrücken. Außerdem besteht bei den Betroffenen meist ein hohes Maß an Selbstmordgefährdung (Suizidalität).
Auch ist die Wahrnehmung der eigenen Gefühle und des Selbstbildes (Identitätsstörungen) gestört. Betroffene fühlen sich dabei fremd in ihrer gewohnten Umgebung und haben keine konkreten Vorstellungen über eigene Wünsche, Ziele oder Bedürfnisse.
Weiterhin versuchen die Menschen mit Borderline oftmals durch verschiedene zwischenmenschliche Mittel andere Personen auf sich aufmerksam zu machen (Agieren). Dabei sind ihre zwischenmenschlichen Beziehungen instabil und dadurch gekennzeichnet, dass sie die andere Person im Wechsel idealisieren und entwerten. Dieses Verhalten entsteht durch die Angst vor Nähe und der gleichzeitigen Angst davor, verlassen zu werden und äußert sich in zeitweisen extremen Klammern und Abweisen der anderen Person. Erfahren die Betroffenen Zurückweisung oder Vernachlässigung einer wichtigen Bezugsperson, sind oftmals unangemessene Wutausbrüche die Folge.
Zusätzlich können weitere Begleitsymptome auftreten:
- Angststörungen
- Zwangsstörungen
- Depressive Episoden
Wie entsteht eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Die Borderline-Erkrankung kann von verschiedenen Einflüssen begünstigt werden. Eine mögliche Ursache stellt eine genetische Veranlagung dar, d.h. Erkrankungen wie die Borderline-Störung treten familiär gehäuft auf. Und auch traumatische Ereignisse in der frühen Kindheit können ursächlich für eine Borderline-Störung sein. Fast zwei Drittel aller Betroffenen haben als Kind die Erfahrungen von sexueller oder körperlicher Gewalt, seelischer Misshandlung oder Vernachlässigung gemacht. Selten begünstigen auch Störungen in Bezug auf Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität (hyperkinetische Störungen) im Kindesalter die Entwicklung von Borderline.
Auch eine geringfügige Funktionsstörung des Nervensystems (minimale zerebrale Dysfunktion) im Kleinkindesalter kann eine Borderline-Störung hervorrufen. Dabei sind betroffene Kinder unter stressarmen Bedingungen unauffällig, zeigen unter Stress jedoch häufig verbale und motorische Entwicklungsstörungen.
Eine weitere mögliche Ursache der Persönlichkeitsstörung liegt auch in einem Ungleichgewicht von Botenstoffen im Gehirn. Zu diesen sogenannten Neurotransmittern zählen unter anderem Serotonin sowie Noradrenalin und Dopamin. Während Serotonin im Gehirn zur Regulation der Impulsivität beiträgt, sorgen Noradrenalin und Dopamin für eine Frustrationstoleranz.
Wie erkennt der Arzt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Um eine Borderline-Störung zu diagnostizieren, führt ein behandelnder Facharzt oder Psychiater zunächst eine Befragung zu familiär auftretenden Persönlichkeitsstörungen sowie psychischen Auffälligkeiten im Kindesalter durch (Anamnese). Hierfür befragt der Arzt nicht nur Betroffene, sondern nach Möglichkeit auch Bezugspersonen, z.B. Eltern.
Bei Verdacht auf eine Persönlichkeitsstörung findet eine Reihe psychologischer Tests statt. Dabei setzen die Fachärzte strukturierte klinische Interviews und verschiedene Checklisten ein, um die Diagnose zu sichern und von anderen Persönlichkeitsstörungen abzugrenzen.
Zusätzlich führt der Arzt Untersuchungen durch, die organische Ursachen als Grund für die Borderline-Störung ausschließen. Neben einer Untersuchung des Blutes überprüft der behandelnde Arzt dabei auch die Schilddrüsenwerte und den Vitamin- und Mineralspiegel der Betroffenen. Weiterhin lassen sich bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomografie (MRT) oder die Elektroenzephalografie (EEG) einsetzen, um das Gehirn genauer zu untersuchen.
Wie behandelt der Arzt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Grundlage einer Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung stellt eine Psychotherapie dar. Dabei kommt die sogenannte dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) zum Einsatz, die als Einzel- oder Gruppentherapie stattfinden kann.
Die Hauptziele der Therapie belaufen sich dabei auf:
- Innere Achtsamkeit
- Den bewussten Umgang mit Gefühlen
- Steigerung des Selbstwertes
- Erlangen einer Stresstoleranz
- Zwischenmenschliche Fähigkeiten
- Umgang und Bewältigung von Problemen
Zusätzlich kann eine medikamentöse Therapie durch einen Facharzt erfolgen, um Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angst zu behandeln. So setzen Ärzte gegen Schlafstörungen und Anspannungszustände sogenannte niedrigpotente Neuroleptika ein. Diese Medikamente blockieren die Andockstelle für den Botenstoff Dopamin im Gehirn, wodurch ein positives Gefühlserleben verstärkt wird.
Gegen depressive Verstimmungen sowie Angst- und Zwangsstörungen werden Antidepressiva häufig eingesetzt. Leiden die Betroffenen zusätzlich unter wahnhaften Symptomen werden Antipsychotika verwendet. Liegt eine erhöhte Gefahr von selbstverletzenden Handlungen vor kann der behandelnde Arzt auf eine Wirkstoffklasse zurückgreifen, die als Benzodiazepine bezeichnet wird. Jedoch besteht hier ein hohes Abhängigkeitspotenzial, sodass der Arzt die Verschreibung sorgfältig und individuell abwägt.
Was können Sie selbst bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung tun?
Wenn Sie unter innerer Anspannung leiden oder dazu neigen, sich selbst zu verletzen, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Dieser kann nach einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen entscheiden, ob eine Überweisung an einen Psychiater oder Psychotherapeuten sinnvoll ist. Nur so lässt sich eine genaue Diagnose stellen.
Die Borderline-Störung galt lange Zeit als ungünstige Prognose, jedoch lassen sich mit den neuen, auf die Erkrankung zugeschnittenen Therapien große Behandlungserfolge erzielen. In ca. 50% der Betroffenen, kann der erste Behandlungsversuch Erfolgreich sein.
Für viele Menschen mit Borderline besteht oftmals ein Interesse daran, etwas über die Borderline-Störung zu erfahren und sich selbst besser zu verstehen. Selbsthilfegruppen und Psychotherapie bieten diese Möglichkeit. In diesem Rahmen lassen sich verschiedene Fähigkeiten zum Umgang mit der Störung sowie gesundheitsfördernde Lebensgewohnheiten erlernen.
Auch für Angehörige ist es empfehlenswert sich gut über die Borderline-Störung zu informieren. Dies kann hilfreich sein, um die Störungen besser einzuordnen und das extreme Verhalten der betroffenen Menschen nicht persönlich zu nehmen.
Veröffentlicht am: 16.03.2023
Quellen
[1]: Pschyrembel Klinisches Wörterbuch online. Borderline (Stand 04.2020). https://www.pschyrembel.de/Borderline-Persönlichkeitsstörung/K0423 (letzter Abruf 12.03.2022)
[2]: Borderline-Störung – Fortschritte der Psychotherapie, Band 14. https://pubengine2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/preview/99.110005/9783840928536_preview.pdf (letzter Abruf 12.03.2022)
[3]: Amboss. Emotionale instabile Persönlichkeitsstörung (Stand 09.02.2022). https://www.amboss.com/de/wissen/Emotional_instabile_Persönlichkeitsstörung/ (letzter Abruf 12.03.2022)
[4]: Chapman J., Jamil R. T., Fleisher C., Borderline Personality Disorder (25.01.2022). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430883/ (letzter Abruf 12.03.2022)
Unsere Qualitätssicherung

„Viele Menschen nehmen dauerhaft eine Vielzahl von Arzneimitteln ein. Dieses kann mit möglichen Problemen und Risiken einhergehen. Ein sicherer Umgang mit Arzneimitteln und die Aufdeckung von Problemen während der Arzneimitteltherapie sind mir daher besonders wichtig."
Die österreichisch approbierte Apothekerin Julia Schink ist im Bereich Patient Care bei SHOP APOTHEKE für die Betreuung von Polymedikationspatienten tätig. Die Ratgeber-Texte von SHOP APOTHEKE sieht sie als tolle Möglichkeit um die Arzneimitteltherapiesicherheit unserer Kunden zu steigern.